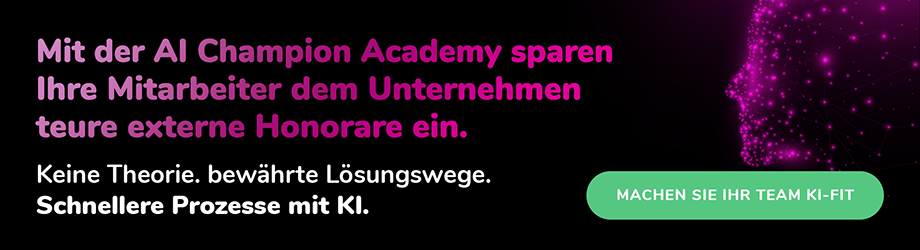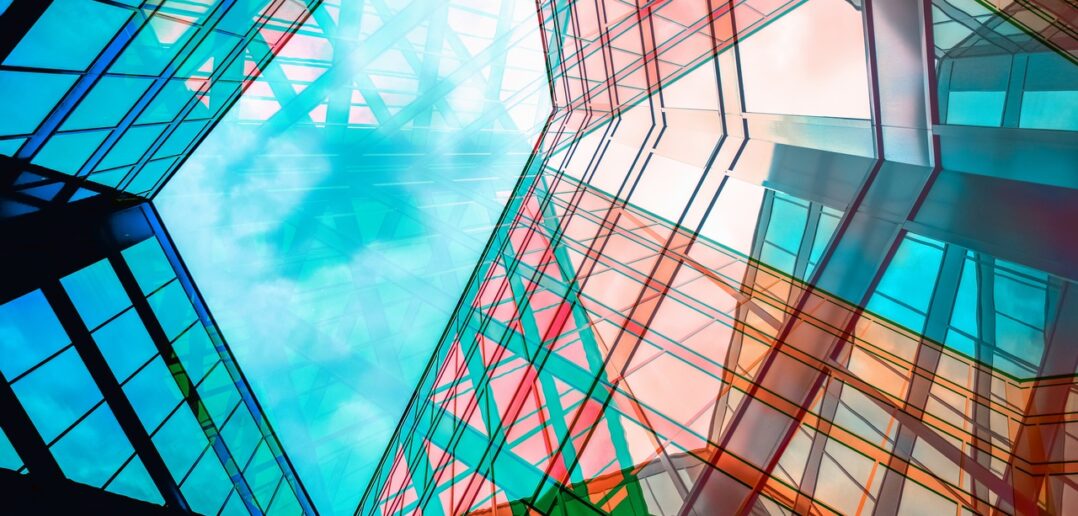Im vorliegenden Fall sollte seitens des Staates Geld eingezogen werden, das als Vermögen aus rechtskräftig festgestellter Geldwäsche entstanden war. Eine Gesetzesänderung bewirkte allerdings, dass der Beklagte nicht mehr strafbar war. Der Staat musste in der Folge auf sein Geld verzichten.
Die rückwirkende Einstellung eines Strafverfahrens
Wird ein Strafverfahren wegen einer Gesetzesänderung, die sich auf vergangene Fälle auswirkt, eingestellt, ist auch eine rechtskräftige Einziehung von Vermögen aus festgestellter Geldwäsche nicht durchführbar. Maßgeblich ist hier die Einstellung des Verfahrens nach Paragraph 206b StPO, durch den das gesamte vorangegangene Verfahren gegenstandslos geworden ist. Selbst bereits rechtskräftige Urteile müssen revidiert und für ungültig erklärt werden. Das Kammergericht in Berlin entschied, dass die materielle Gerechtigkeit Vorrang vor der formalen Rechtssicherheit habe. Die Gesetzesänderung hat die frühere Strafbarkeit in dem Fall beseitigt. Dieser ist ein perfektes Beispiel, wenn ein Fachanwalt Strafrecht und seine teils überraschenden Urteile näher erläutern möchte.
Die Verfahrenseinstellung nach § 206b StPO
Ein Gerichtsverfahren kann gemäß § 206b StPO eingestellt werden, was bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft oder auch das Gericht selbst ein Verfahren für beendet erklärt. Diese Beendigung gilt allerdings erst einmal vorläufig. Möglich wird sie, wenn ein Angeklagter oder eine vom Verfahren betroffene Person nicht auffindbar ist oder wenn sie an der Hauptverhandlung nicht teilnehmen kann. Letzteres ist weniger wegen einer zeitlichen Verfügbarkeit, sondern vielmehr wegen einer dauerhaften Verhandlungsunfähigkeit gemeint. Das bedeutet, dass es keinen Schuldspruch gibt, kein Urteil und auch keine Unschuldsfeststellung. Das Verfahren kann später wieder aufgenommen werden. Die Verfahrenskosten muss der Staat tragen, die vorläufige Einstellung des Verfahrens ist nicht an Auflagen gebunden.
Keine rechtliche Grundlage für die Einziehung von Vermögen
Das im Folgenden beschriebene Verfahren am Kammergericht Berlin (Aktenzeichen 2 Ws 20/22 – 161 AR 19/22) endete mit dem Urteil, dass eine rechtskräftige Einziehung von Vermögen nach einer Gesetzesänderung sowie nach Verfahrenseinstellung rechtlich unzulässig sei. Der Grund: Das zugrunde liegende Strafverfahren wurde wegen einer rückwirkenden Änderung des Gesetzes eingestellt, damit besteht keinerlei rechtliche Handhabe, um das Vermögen aus einer Geldwäsche einzuziehen. Interessant: Das gilt sogar dann, wenn bereits Teile des Urteils rechtskräftig umgesetzt worden sind.
Zum Fall:
Eine Verurteilung durch das Landgericht Berlin vom 12. Januar 2018 wegen vorsätzlicher Geldwäsche in 75 Fällen sollte mit einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten geahndet werden. Außerdem wurde ein Wertersatz über 74.597,40 Euro festgelegt. Dieser sollte eingezogen werden und entsprach den Geldern, die durch die Geldwäsche in den Besitz des Beklagten gelangt sind. Seine Geldwäschegeschäfte ereigneten sich zwischen 2005 und 2011 in Form eines illegalen Rauchtabakimports. Der Beklagte hinterzog Einfuhrsteuern in Höhe von mehr als 45 Millionen Euro. Er wurde am 11. März 2013 wegen Steuerhinterziehung und Schmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt.
Im vorliegenden Verfahren ging es um Verfügungen über die Erlöse aus den illegalen Geschäften, die der Beklagte nach seiner Haftstrafe erhielt. Gegen das Geldwäsche-Urteil legte er Revision beim Bundesgerichtshof ein, der am 27. November 2018 den einstigen Schuldspruch abänderte. Der Beklagte war jetzt nur noch in 18 Fällen der Geldwäsche schuldig. Damit reduzierte sich auch der Wertersatz, der eingezogen wurde, auf 59.024,49 Euro. Wichtig: Der BGH hob nur die zweieinhalbjährige Freiheitsstrafe auf, eine erneute Verhandlung darüber sollte an einer anderen Strafkammer des Landgerichts Berlin stattfinden. Eine sogenannte horizontale Teilrechtskraft lag vor – damit darf das Urteil nicht angefochten oder der Teil des Urteils neu verhandelt werden. Über die Höhe der Strafe musste indes noch entschieden werden.
Überraschung: Staatsanwalt beantragt Einstellung des Verfahrens
Die vorläufige Einstellung des Verfahrens erfolgte am Landgericht Berlin am 2. April 2019. Gleichzeitig wurde eine Änderung im Strafgesetzbuch gültig, die als „Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche“ bekannt ist. Dadurch wurde der Paragraph 261 Abs. 1 Satz 3 StGB in der alten Fassung gestrichen und das auch noch rückwirkend. Die Handlungen, für die der Angeklagte einst verurteilt worden war, waren nun nicht mehr strafbar. Die Staatsanwaltschaft Berlin stellt nun einen Antrag auf Verfahrenseinstellung nach Paragraph 206b StPO und das Landgericht Berlin folgte dem Antrag. Mit Beschluss vom 20. Juli 2021 wurde das Verfahren nun eingestellt. Hintergrund war, dass sich erst nach Beginn der Hauptverhandlung herausgestellt hatte, dass die Tat, die einst zur Verurteilung des Angeklagten geführt hat, nicht mehr gültig ist. Der Angeklagte beantragte daraufhin eine Entschädigung für die vergangenen Maßnahmen zur Strafverfolgung, diese wurden ihm jedoch gerichtlich versagt. Rechtskräftig wurde danach der Einstellungsbeschluss verkündet, eine Anfechtung desselben fand von keiner Seite statt.
Keine Vollstreckung von Vermögenswerten
Neben der Freiheitsstrafe bekam der Angeklagte die Herausgabe der Vermögenswerte aus den Geldwäschegeschäften auferlegt. Nach Einstellung des Verfahrens und Erklärung der Ungültigkeit des vorangegangenen Urteils stellte sich jetzt die Frage, ob die Vollstreckung des Vermögens immer noch rechtskräftig sei. Die Staatsanwaltschaft Berlin vertrat die Auffassung, dass eine Entscheidung über die Einziehung des Vermögens in Höhe von 59.024,49 Euro nicht rückgängig gemacht werden könne und von § 206b StPO nicht berührt werde. Der Angeklagte sah dies anders und beantragte die Unzulässigkeit der Vollstreckung.
Vollstreckung wurde für unzulässig erklärt
Am 22. Dezember 2021 erließ das Landgericht Berlin einen Beschluss, in dem es die Vollstreckung des Vermögens des Angeklagten für unzulässig erklärte. Die Staatsanwaltschaft legte umgehend Beschwerde beim Kammergericht ein. Doch auch dieses entschied: Die Vollstreckung der Einziehung sei endgültig nicht zulässig, die Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen den vorliegenden Beschluss wurde als unbegründet zurückgewiesen. Damit war die Entscheidung des Landgerichts bestätigt. Zur Begründung:
-
Wird ein Verfahren nach § 206b StPO eingestellt, macht dies ein zugrunde liegendes Urteil in seiner Gesamtheit gegenstandslos. Eine gesonderte Aufhebung für einzelne Teile des Urteils ist nicht nötig.
Die Einstellung des Verfahrens entspricht einer materiell-rechtlichen Entscheidung, was wiederum inhaltlich einem Freispruch gleichkommt. Die Strafklage ist damit verbraucht, das Verfahren beendet. Für die Betroffenen müsste die günstigste Gesetzeslage angewendet werden und diese besagt, dass eine vollständige Aufhebung des Urteils dem teilweisen Urteil übergeordnet ist. -
Ohne vorliegende Straftat kann es auch keine Einziehung des Vermögens geben. Diese wäre an eine rechtswidrige Straftat gebunden, die jedoch aufgrund der Änderung des Gesetzes nicht mehr vorliegt. Damit sind die erzielten Erlöse aus der Tat nicht mehr widerrechtlich erworben. Es kann keinen Schuldspruch ohne Schuld geben, ebenso ist ein Schuldspruch ohne Strafe im deutschen Strafrecht nicht erlaubt. Die Einziehung wäre eine Strafe ohne Basis einer Schuld und dies ist nicht umsetzbar.
-
Offen blieb, ob eine Trennung des aufgehobenen Urteils von der Einziehung des Vermögens möglich gewesen wäre. Vielmehr wurde die Entscheidung damit begründet, dass es keine solche Ausnahmeregelung im Beschluss zur Einstellung des Verfahrens vom 20. Juli 2021 gab. Es fand sich keinerlei Hinweis darauf, dass die Einziehung von der Einstellung getrennt zu betrachten sein müsse. Eine solche ausdrückliche Herausnahme hätte es im Sinne der Rechtssicherheit aber geben müssen. Zudem hatte es die Staatsanwaltschaft versäumt, eine solche Beschränkung zu beantragen.
Staatskasse muss die Verhandlungskosten tragen
Nicht nur, dass der Staat nun auf die Einziehung des Vermögens verzichten muss, ist es im Anschluss an das Verfahren auch noch seine Aufgabe, die Kosten dafür zu tragen. Die Landeskasse übernimmt die Kosten, die für das Beschwerdeverfahren angefallen sind, was sich aus Paragraph 473 StPO ergibt.
Das Kammergericht hat damit zugunsten des Klägers entschieden, der nun in allen Punkten frei ist. Es hat gezeigt, dass es möglich ist, auch rechtskräftige Urteile nach einer entsprechenden rückwirkenden Gesetzesänderung für unwirksam zu erklären.